Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung werden wir traditionsgemäß den Abend mit unserer Reihe „Neues aus der Stadtgeschichte“ fortsetzen.


Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung werden wir traditionsgemäß den Abend mit unserer Reihe „Neues aus der Stadtgeschichte“ fortsetzen.
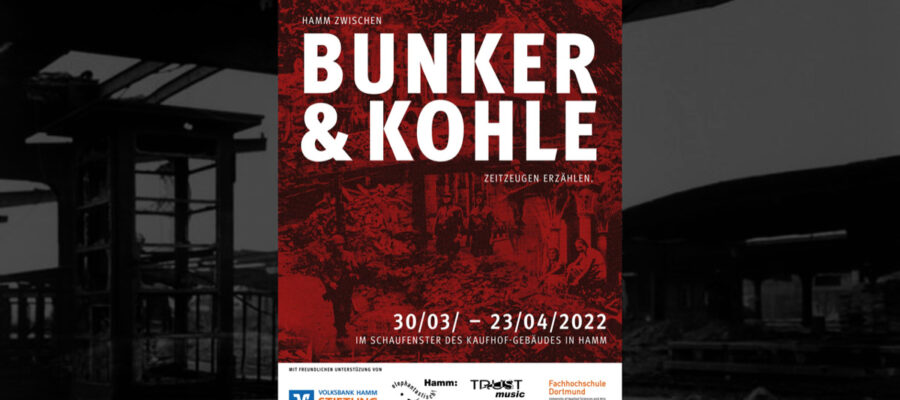
Zeitzeugen und Zeitzeuginnen erzählen aus früheren Zeiten in der Stadt Hamm und über die Stadt Hamm in früheren Zeiten.

Der russische Überfall auf die Ukraine hat uns an die Einladung des Künstlerehepaars Pötter erinnert, das den „Engel der Feindesliebe“ in der Johanneskirche gestaltet hat.
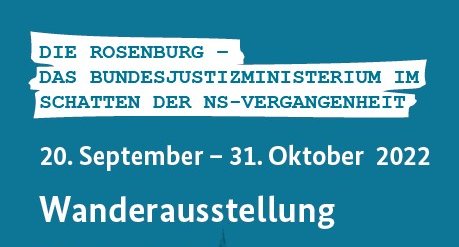
Das Bundesministerium der Justiz im Schatten der NS-Vergangenheit
Die „Rosenburg“ in Bonn war von 1949 bis 1973 der Sitz des Bundesministeriums der Justiz, das allerdings auch mit dem alten Personal der NS-Zeit arbeitete. Die Folgen sind Thema dieser Ausstellung.

Am ersten Febraur 1901 wurde eine 16 Kilometer lange Schmalspurbahn von Werl über Rhynern nach Hamm eröffnet und der Bahnhof Rhynern-West in Betrieb genommen.

Die Familie de Wendel, deren Ursprünge auf das 17. Jahrhundert zurückgehen, wurden „Könige des französischen Stahls“ genannt.
1900 erwarb sie in Herringen ein Grubenfeld.

Als Folge des Zweiten Weltkriegs gelangten Menschen aus Polen nach Hamm und verstarben hier. Einige ihrer Gräber finden sich noch heute auf dem Hammer Südenfriedhof, der damit auch zum Erinnerungsort deutsch-polnischer Geschichte wird.

Das erstmals 1284 erwähnte Wasserschloss Oberwerries zählt zu den kulturhistorisch wertvollsten Gebäuden der Stadt Hamm.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude am Theodor-Heuß-Platz 16 weist Spuren für alle Epochen seiner wechselvollen Geschichte auf. Fertig gestellt wurde es 1894 für das Preußische Oberlandesgericht Hamm. 1959 wurde es zum Hammer Rathaus.

Der Burghügel Mark mit den Resten der ehemaligen Burganlage der Grafen von der Mark wurde durch die Stadt Hamm umfangreich saniert und neu gestaltet.